Im Dienste der Verstorbenen

Conny und Florian vor dem Institut für Rechtsmedizin. (Foto: Aline Haslebacher)
Am Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern werden unter anderem Obduktionen durchgeführt, es wäre jedoch verfehlt, die rechtsmedizinische Tätigkeit darauf zu reduzieren. Die studizytig im Gespräch mit zwei Mitarbeiter*innen des Instituts über ihren Beruf, die Darstellung desselben in Krimiserien – und warum der Tod auch mit dem Leben zu tun hat.
Seit der Gründung der Universität Bern 1834 gehört die Rechtsmedizin zum universitären Programm. Damals noch mit der sogenannten hygienisch-gesetzgebenden Medizin verbunden, entwickelte sie sich mit der Zeit zu einem eigenständigen Institut, das alle Teildisziplinen der Rechtsmedizin unter einem Dach vereint – zumindest organisatorisch. In der physischen Welt sind die insgesamt sieben Disziplinen über ganz Bern verteilt. Längst nicht alle davon beschäftigen sich mit Obduktionen bzw. Autopsien und Gewaltverbrechen, wie es kriminalistische Serien, Filme oder Bücher oft vermitteln. Tatsächlich übernimmt grösstenteils die Abteilung für forensische Medizin und Bildgebung diesen Aufgabenbereich. Die forensische Molekularbiologie sowie die forensische Toxikologie und Chemie sind dafür zuständig, Proben zu analysieren – sei es von Personen, deren Todesursache zu klären ist, oder auch von lebenden Personen, beispielsweise in Zusammenarbeit mit der Verkehrsmedizin. Bei der Molekularbiologie geht es dabei hauptsächlich um DNA-Analysen zur Vaterschaftsbestimmung, Spurenuntersuchung und Identifikation, während die Toxikologie sich auf den Nachweis von Drogen, Giften oder ähnliche Substanzen konzentriert. Die vorangehend erwähnte Verkehrsmedizin befasst sich hingegen primär mit den Lebenden und führt unter anderem Abklärungen zur Fahreignung von Verkehrsteilnehmer*innen durch. Auch der forensisch-psychiatrische Dienst tritt kaum in Berührung mit Verstorbenen. Seine Mitarbeiter*innen erstellen beispielsweise Gutachten von Straftäter*innen, bei denen ein Verdacht auf eine psychische Störung besteht. Die Anthropologie beschäftigt sich meist weder mit Lebenden noch mit aktuellen Todesfällen: Sie kommt u.a. bei einem Skelettfund zum Zuge, bei dem sich schwerlich eine Obduktion durchführen liesse. Meist handelt es sich dabei um Funde auf Baustellen oder Gletschern, die von historischer Bedeutung sein könnten. Weiter ist dem Institut für Rechtsmedizin auch noch das Medizinrecht angegliedert. Bei dieser Abteilung landen beispielsweise Fälle aus Spitälern, bei denen unter Umständen die ärztliche Sorgfaltspflicht verletzt wurde. Insgesamt beschäftigt das Institut für Rechtsmedizin etwa 150 Mediziner*innen und Naturwissenschaftler*innen, die für den gesamten Kanton Bern und das Oberwallis zuständig sind. Teilweise werden auch Fälle von anderen Kantonen übernommen, unter anderem aus dem Aargau, da das dortige Institut für Rechtsmedizin ans Kantonsspital angegliedert ist und deshalb in gewissen Fällen befangen sein könnte.
Längst nicht alle Rechtsmediziner*innen beschäftigen sich mit Obduktionen bzw. Autopsien und Gewaltverbrechen, wie es kriminalistische Serien, Filme oder Bücher oft vermitteln.
Hinter den Türen des IRM
In das rechtsmedizinische Institut an der Bühlstrasse 20 kann nicht einfach hineinspaziert werden – eine doppelte Sicherheitsschleuse verhindert, dass nicht-berechtigte Personen Zutritt haben. Ist die erste Tür passiert, folgt ein Empfangsbüro, bei dem eine Anmeldung vorliegen muss. Nach Erhalt eines Besucher*innen-Badges öffnet sich die zweite Tür zu dem etwas verwirrenden Innenleben des Instituts mit vielen Abzweigungen und Räumen und steilen, engen Treppen. Im Untergeschoss, wo sich einige Büros befinden, warten bereits Conny und Florian, die beide als Assistenzärzt*in bei der Abteilung für forensische Medizin und Bildgebung arbeiten. Sie haben heute Dienst, könnten also jeden Moment zu einem Einsatz gerufen werden. «Ein Dienst dauert normalerweise 24 Stunden», erklärt Florian, «allerdings gibt es teilweise viele Pausen zwischen den Einsätzen». An dienstfreien Tagen arbeiten die Ärzt*innen der Abteilung für forensische Medizin und Bildgebung meist im Büro oder führen eine Autopsie im Obduktionssaal durch. «Das führt dazu, dass wir eigentlich geregeltere Arbeitszeiten haben als andere Mediziner*innen, auch wenn die Dienste sehr streng sein können», meint Florian weiter. Ausrücken müssen die beiden, wenn ein*e Ärzt*in bei einem Todesfall in der ärztlichen Todesbescheinigung «nicht-natürlich» oder «unklar» ankreuzt. Diese zwei Kategorien zusammen bilden die «aussergewöhnlichen Todesfälle», kurz AgTs, mit denen sich die Mediziner*innen des Instituts beschäftigen. Darunter fallen jedoch nicht nur Tötungsdelikte, wie man vielleicht reflexartig annehmen würde, sondern sämtliche Todesfälle, bei denen eine Fremdeinwirkung nicht ausgeschlossen werden kann oder der Todeseintritt unerwartet war, wie es beispielsweise bei Unfällen oder Suizid der Fall ist. Vor Ort führen die Rechtsmediziner*innen als Erstes eine sogenannte Legalinspektion am Leichnam durch, um dessen Identität festzustellen, den Todeszeitpunkt einzuschätzen und eine mögliche Fremdeinwirkung abzuklären.
Ausrücken müssen die beiden, wenn ein*e Ärzt*in bei einem Todesfall in der ärztlichen Todesbescheinigung «nicht-natürlich» oder «unklar» ankreuzt.
Dabei wird der Leichnam von Kopf bis Fuss auf Hautveränderungen und/oder Verletzungen untersucht. Der/die Staatsanwält*in fällt dann die Entscheidung, ob der Leichnam zur Bestattung freigegeben werden kann oder ob eine Obduktion durchgeführt werden muss. Eine Ausnahme von diesem Ablauf bilden unter anderem Sexualdelikte, wie Vergewaltigungen, bei denen die Rechtsmediziner*innen im Rahmen des Berner Modells direkt von der Frauenklinik und nicht von der Staatsanwaltschaft aufgeboten werden können. Dies soll die Hemmschwelle für die Betroffenen senken ins Spital zu gehen, da sie sich so ohne Einschaltung der Polizei untersuchen lassen können. Anders gestaltet sich auch die Lage bei Suizidbegleitungen durch die Sterbehilfeorganisation Exit: Da es sich dabei um geplante, nicht-natürliche Todesfälle handelt, geht gleich von Beginn an ein*e Rechtsmediziner*in vor Ort, um den Tod festzustellen und den korrekten Hergang zu untersuchen. Dadurch wird der Personalaufwand erheblich verringert.
Dies soll die Hemmschwelle für die Betroffenen senken ins Spital zu gehen, da sie sich so ohne Einschaltung der Polizei untersuchen lassen können.
«Jedes Detail ist entscheidend»
Fällt der Entscheid für die Durchführung einer Obduktion, wird der Leichnam ins Institut für Rechtsmedizin gebracht. Bei der Obduktion werden alle grossen Körperhöhlen geöffnet – gemeint sind damit Kopf, Brustkorb und Bauchraum. Dabei werden alle Organe entnommen und auf Veränderungen untersucht, die Hinweise darüber liefern könnten, wie die Person zu Tode gekommen ist. Anschliessend werden die Organe dem Leichnam wieder zurückgegeben. Auch CT-Scans kommen zum Zuge, um der möglichen Todesursache auf die Spur zu kommen. Die Resultate werden dann in einem Gutachten zusammengefasst, das an die Staatsanwaltschaft geht und bei einem allfälligen Gerichtsverfahren Verwendung findet. «Wir sind sozusagen die ‹Dolmetscher*innen› zwischen Mediziner*innen und den Strafverfolgungsbehörden, daher müssen wir sehr genau auf die sprachlichen Formulierungen in den Berichten achten», führt Conny aus und Florian fügt an: «Jedes Wort wird auf die Waagschale gelegt, jedes Detail ist entscheidend für das Verfahren.» Bis zur Freigabe des Leichnams haben die Rechtsmediziner*innen jedoch nicht nur mit den Verstorbenen zu tun, sondern auch mit deren Angehörigen. «Wir werden schon immer wieder von Angehörigen angerufen, die wissen möchten, was genau ihrem Mann oder ihrer Tochter zugestossen ist – darüber dürfen wir jedoch leider keine Auskunft erteilen, ohne das Einverständnis der Staatsanwaltschaft eingeholt zu haben», sagt Florian. «Wir versuchen den Hinterbliebenen Unsicherheiten zu nehmen und sie im Prozess des Abschliessens zu begleiten. Es ist durchaus Teil unserer Arbeit, für die Angehörigen da zu sein», meint Conny. Sowieso geht oft vergessen, dass sich die Rechtsmedizin mitnichten nur auf die Toten fokussiert. Das Verhältnis sei etwa 50/50, schätzt Florian, denn sie würden ja auch Opfer von Körperverletzungen, Sexualdelikten und häuslicher Gewalt untersuchen, die keine Todesfolge hatten. Dieses Verhältnis ist unter anderem den unterschiedlichen Entwicklungen der Rechtsmedizin geschuldet: In Frankreich steht eher die klinische Rechtsmedizin und somit die Untersuchung der Lebenden im Fokus, im deutschen Sprachraum eher die kausalanalytische Untersuchung der Toten. «Die Welschschweiz orientiert sich an der rechtsmedizinischen Geschichte Frankreichs, die Deutschschweiz eher an der des deutschen Sprachraums», erklärt Conny.

Sektionstisch mit einigen Instrumenten, die bei einer Obduktion Verwendung finden. (Foto: Conny Hartmann)
«Wir sind sozusagen die ‹Dolmetscher*innen› zwischen Mediziner*innen und den Strafverfolgungsbehörden»
Die CSI-Utopie
Weg von der realen Rechtsmedizin, hin zur fiktionalen: In Krimi-Serien, -Filmen und -Büchern kommen regelmässig Rechtsmediziner*innen vor, die die ermittelnden Hauptfiguren unterstützen. Darauf angesprochen, meinen Conny und Florian lachend: «Also die amerikanischen Serien wie beispielsweise CSI sind gar nicht realitätsgetreu. Da finden die Rechtsmediziner*innen manchmal Dinge heraus, die überhaupt nicht möglich sind». Ein Klassiker ist beispielsweise die Feststellung der Todeszeit, die in den Filmen meist auf die Minute genau bestimmt werden kann – in der Realität kann man jedoch bestenfalls ein mehrstündiges Zeitfenster angeben. Wirklichkeitsgetreuer ist zum Beispiel der Tatort, aber auch dort wird die Genauigkeit teilweise dem Plot geopfert. «Klar, es geht ja um Unterhaltung am Fernsehen, einige Teile unserer Arbeit wären da für das Publikum sehr langweilig», konstatiert Florian. Deshalb werden in Serien und Filmen auch die spektakulären Fälle gezeigt, die in der Realität eine sehr kleine Prozentzahl ausmachen: Schon die Anzahl an Tötungsdelikten sei nicht sehr hoch – etwa eines alle zwei Monate – und ein wirklich aufsehenerregender Fall käme vielleicht alle zwei oder drei Jahre vor, wie Florian erklärt. Angesprochen auf ein weiteres gängiges Klischee, nämlich die Darstellung von Rechtsmediziner*innen als etwas merkwürdige Charaktere, die ihre Zeit durchgehend im kalten Keller bei den Leichen verbringen, meint Conny lachend: «Naja, spezielle Persönlichkeiten finden sich auch unter uns, aber wir sind bei weitem keine sonderbaren Eigenbrötler – ausserdem werden die Obduktionen im zweiten Stock in einem Saal mit Fenstern durchgeführt, bei Raumtemperatur». «Wir sind also keine Kellerkinder», fügt Florian mit einem Schmunzeln an.
Der Tod widerspiegelt auch das Leben
Für die meisten Menschen ist die Vorstellung ungewöhnlich, jeden Tag mit dem Tod zu tun zu haben, wie es der Alltag von Rechtsmediziner*innen erfordert. Auch Conny und Florian bestätigen, dass es zuerst ein spezielles Gefühl ist, mit einer so grossen Anzahl an Todesfällen konfrontiert zu sein. «Man muss sich zwangsläufig daran gewöhnen und lernen, sich zu distanzieren», sagt Florian. Auch dann gingen einem einige Fälle immer noch sehr nahe, insbesondere wenn man sich damit identifizieren könne. Gewöhnungsbedürftig war für Florian zu Beginn auch, dass am Fundort eines Leichnams eine gute Stimmung herrschen und auch über belanglose Themen gesprochen werden kann, bevor mit der Arbeit begonnen wird.
Die «Mödeli» einer Person sind unverfälscht erkennbar – sei es, dass jemand ein Messie war, merkwürdige Dinge gesammelt oder einen Putzfimmel gehabt hat.
«Natürlich sind wir nicht respektlos dem Leichnam gegenüber, aber warum sollte man nicht auch mal lachen oder über ganz alltägliche Dinge sprechen dürfen?» Conny betont, dass man als Rechtsmediziner*in zwar viel mit dem Tod zu tun habe, der Sterbeprozess jedoch häufig das eigentlich Schlimme sei. «Pfleger*innen beispielsweise bauen eine Beziehung zu ihren Patient*innen auf, kennen diese und kümmern sich um sie. Diese Person dann sterben zu sehen, ist deutlich schwieriger, als ihren Leichnam zu untersuchen», stellt sie fest. Im Tod sehen die beiden auch ein Fenster zum Leben: Gerade wenn man an einen Fundort gehe, begegne man unterschiedlichsten Wohnverhältnissen und Lebensweisen, die von aussen nicht unbedingt ersichtlich sind. Die «Mödeli» einer Person sind unverfälscht erkennbar – sei es, dass jemand ein Messie war, merkwürdige Dinge gesammelt oder einen Putzfimmel gehabt hat. «Bevor man unerwartet stirbt, räumt man schliesslich nicht auf», sagt Florian. Für die beiden hätte sich durch die tägliche Berührung mit dem Tod grundsätzlich nicht allzu viel geändert. In gewissen Situationen seien sie sich der alltäglichen Gefahren bewusster, da sie wissen würden, wie schnell etwas schief laufen könne. «Zum Beispiel trage ich jetzt immer einen Velohelm», meint Florian. Sie würden jedoch nicht viel häufiger an die Endlichkeit des Lebens denken, oder zumindest keine wirklichen Konsequenzen daraus ziehen. Conny merkt an: «Ein Arzt weiss schliesslich auch, dass Rauchen ungesund ist und tut es mitunter trotzdem. Wir sind da nicht anders». Ihr Fazit: Der Tod sollte in der Gesellschaft kein Tabuthema sein, doch man sollte ihn sich auch nicht andauernd vor Augen halten im Sinne eines «Memento Mori».





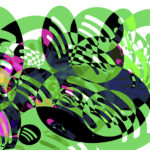

CSI Berne