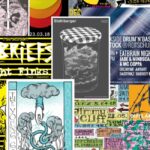Maximal involviert durch die Kulturszene

Die KSB-Gang in ihrer Küche (v.l.): Roland Fischer, Mirko Schwab, Urs Rihs, Jessica Jurassica und Alice Galiza. Foto: zvg
Der Berner Untergrundjournalismus lebt! Das online Kulturmagazin KSB hat nun 22 Lieblingstexte aus zwei Jahren unabhängiger Kulturberichterstattung als kleine gedruckte Sammlung veröffentlicht.
Während die TX Group die beiden Berner Tageszeitungen «Berner Zeitung» und «Der Bund» zusammenlegen will und deren Kulturredaktionen empfiehlt, mehr über Netflix-Serien zu schreiben, lebt auf ksb.ist der Kulturjournalismus weiter. Unorthodox im Stil und radikal subjektiv in der Betrachtung schreibt KSB seit nun zwei Jahren aus der und über die Kulturszene Berns. Ihre Lieblingstexte aus diesen zwei Jahren hat die Redaktion nun zusammengetragen und in gedruckter Form unter dem Titel «Durchgehend warme Küche» veröffentlicht.
Das online Kulturmagazin KSB entstand aus dem Bund-Blog «KulturStattBern», nach einem längeren Abnabelungsprozess. An dessen Ende standen mehrere gelöschte Einträge und ein Schreibverbot für die gerade erst dazugestossene Autorin Jessica Jurassica. Doch das ist längst passé. Oder wie es KSB-Autorin Alice Galizia sagt: «Es geht jetzt auch schon länger nicht mehr um diese Trennung. Du magst ja auch nicht ständig über deine*n Ex reden, wenn du dir längst ein neues Leben aufgebaut hast.» Fair. Sprechen wir also über die Gegenwart und das Büchlein «Durchgehend warme Küche». Doch wie lässt sich eine Textsammlung besprechen, in der die Autor*innen ständig nach neuen Formen der Kulturberichterstattung suchen?
Die klassische Form der «Besprechung» ist jedenfalls schon mal eine Anmassung, denn zum Besprechen brauchts mindestens zwei und sowieso entsteht Kultur immer durch Austausch und Diskurs. Deshalb habe ich Alice Galizia meine Gedanken und Fragen zu «Durchgehend warme Küche» geschickt und sie um eine Reaktion gebeten:
Ist es nicht ironisch, dass die Idee einer neuen Onlinestrategie eines grossen Schweizer Verlegers nun über Umwege in gedruckter Form ihre Vollendung findet?
Ich würde das keineswegs als Vollendung bezeichnen, Print war nie tot, online bleibt und ausserdem brauchten wir Weihnachtsgeschenke, hat sich
also angeboten.
KSB hält in Bern die Gonzofaust hoch.
Was ist das denn, Gonzo? Sich auf irgendwelchen Drogen über die Welt auskotzen? Auf MDMA in die Masoala-Halle? Machen wir eher nicht. Ich würde sagen: Wenn, dann ist Gonzo maximale Involvierung, ein sich Aussetzen, bis es schmerzt. Das machen wir manchmal, oft auch nicht – subjektives Schreiben kennt tausend Versuche und Ausgestaltungen. Und wenn Gonzo nur ein Name dafür ist, dass da irgendwie Dreck dranklebt, bringt er uns nirgends hin, ist er nur Reminiszenz an ein längst im Acid verdampftes Gefühl, ist er tot. Und auch: langweilig geworden.

«Auf dem Weg nach oben habe ich die Schweiz durchquert.», Urs Rihs in «König der Seifenblase». Foto: zvg
Die KSB-Autor*innen schreiben nicht vom Hochsitz der Kritiker*innen. Sie sind stets auch irgendwie Teil der Kultur und schreiben zmitzt usem Chuechä. Kann das in jedem Fall gut gehen oder braucht es manchmal auch den Blick von aussen?
Das geht natürlich ständig schief, manchmal auch nicht. Ich sehe kein Problem darin, involviert zu sein, jeder gute Kulturjournalismus braucht eine Haltung, ist in dem Sinne subjektiv – ich würde also behaupten, dass es «den Blick von aussen» gar nicht gibt. Man muss nur aufpassen, dass man auch kritisch bleibt.
Braucht eine lebendige Kulturszene auch eine entsprechende Kulturberichterstattung? Wie sähe der Kulturstandort Bern ohne euch aus?
Naja, natürlich. Kultur passiert im Austausch, da muss das Darüberschreiben ein Teil davon sein. Der «Kulturstandort» Bern sähe natürlich genau gleich aus, der interessiert sich weniger für uns als für eine neue Festhalle auf der Allmend.
Im Jahr 2019 finden sich sowohl Texte aus dem Leben als auch Berichte von kulturellen Anlässen. Bei Letzteren fällt auf, dass auf eine abschliessende Beurteilung bzw. Einordnung verzichtet wird. Vielmehr enthalten die Texte viel Angedachtes und Denkanstösse, die Leserin wird mit einem vagen Gefühl zurückgelassen. Ob das wohl bewusst so gewählt oder eine logische Folge davon ist, wie die Autor*innen über Kunst denken?
Es ist ein Luxus, kein Urteil abgeben zu müssen, in dem Sinne: keine Kaufempfehlung zu machen. Das ist gut, so muss man sich nicht immer entscheiden, kann auch mal ein Gefühl vermitteln, über Sachen schreiben, die schon passiert sind und die sonst in der Echokammer verschwänden. Kann sich auch ausprobieren und Schwachsinn fabrizieren und zurückgepfiffen werden, das ist schon eine sehr privilegierte Position.
Dieses Jahr fanden kaum kulturelle Anlässe statt, was sich auch im zweiten Teil von Durchgehend warme Küche zeigt. Die Texte handeln mehr von der Auseinandersetzung mit der unmittelbaren Aussenwelt. Sie werden literarischer, sind reflexiver und die Bedeutung von Kultur im städtischen Leben steht vermehrt im Zentrum. Vielleicht ist dies ein positiver Aspekt, der sich der Krise abgewinnen lässt: Im sous-vide des covidbedingten Kulturvakuums werden die rohen Gedanken, die die Kunst zuvor in unsere Köpfe gelegt hat, weiter gegart.
Vielleicht ist das ein positiver Aspekt, wahrscheinlicher aber ist das alles eine einzige grosse Scheisse. Es tut einem schon gut, nicht zu sehr auf sich selbst zurückgeworfen sein.