«Ich glaube nicht so sehr an Systeme, ich glaube an Beziehungen.»

Lukas Bärfuss, Schriftsteller und Dramaturg. Bild: Sam von Dach
Vor seiner Lesung am Collegium Generale der Universität Bern traf die bärner studizytig Lukas Bärfuss zum Gespräch. Der Schweizer Autor plauderte dabei nicht nur aus der Schule, er diskutierte mit uns auch über frühe Berufswünsche, überholte territoriale Vorstellungen und undankbare Geburtstage.
Herr Bärfuss, Sie halten gleich eine Lesung an einer Universität. Was hätten Sie denn gerne studiert oder möchten Sie womöglich noch studieren?
Ich hätte wahrscheinlich Archäologie oder Paläontologie studiert, jedenfalls war Archäologe zusammen mit demjenigen des Käsers mein erster Berufswunsch. Schriftsteller ist ein gutes Amalgam aus beiden Berufen, wie ich finde. Bei der Archäologie geht es ja darum den Boden umzugraben, um darin vielleicht menschliche Spuren zu entdecken. Dieses Forschende und auch Penible mit Pinsel und Meissel hat sehr viel gemein mit dem Schreiben. Beim Käsen hingegen handelt es sich um eine Konservierungsmethode. Die Milch, die leicht verderblich ist, rührt und kocht man so lange, bis sie haltbar wird. Ich glaube, das ist auch etwas, was die Literatur versucht: aus dieser flüchtigen Wirklichkeit, die uns immer zerrinnt in den Fingern, etwas zu machen, das Bestand hat.
Nun ist es bekanntlich nicht so gekommen – Sie sind weder Archäologe noch Käser geworden. Weshalb?
Käser bin ich nicht geworden, weil ich irgendwann mal feststellen musste, dass meine Vorstellung von diesem Beruf wahrscheinlich nicht wirklich dem Berufsalltag entsprach. Ich hatte einen Cousin, der doppelt so gross und doppelt so breit war wie ich, und selbst er hat sich immer beklagt, wenn er die hundert Kilogramm schweren Emmentalerlaibe wenden musste. Vielleicht gibt es heute Roboter, die das übernehmen, aber ich hatte nicht die physische Konstitution dazu. Dieser Wunsch hat sich dann irgendwann aufgelöst, wie das mit vielen kindlichen Wünschen geschieht. Und an die Uni ging ich nicht, weil ich für eine höhere Schulbildung keine Gelegenheit hatte, ganz einfach. Ich musste sehr früh auf eigenen Beinen stehen, mein eigenes Geld verdienen und hatte niemanden, der mir die Ausbildung bezahlt hätte. Deshalb konnte ich das Privileg einer universitären Ausbildung nicht geniessen.
Sie beschreiben in Ihrem Essay „der Feuerofen“, eine gewisse Perspektivlosigkeit, die Schuld daran trug, dass Sie schulisch eher desinteressiert waren.
Ja. (lacht)
Ist es die Aufgabe der Schule eine Perspektive zu schaffen?
Diese Perspektivlosigkeit hatte erstens etwas zu tun mit dem Ort, an dem ich aufgewachsen bin und zweitens mit der Zeitgeschichte. In den Achtzigerjahren herrschte ein janusköpfiger Zeitgeist: auf der einen Seite sehr hedonistisch, sehr lebenszugewandt, im Augenblick verweilend, aber gleichzeitig perspektivlos, weil man doch immer noch in diesem bipolaren Weltsystem lebte. Bis 1989 hatte man keine Vorstellung davon, wie das jemals hätte überwunden werden sollen. Erst durch die Übernahme von Gorbatschow kam Bewegung in diese Erstarrung. Aber als ich zu pubertieren begann und meinen persönlichen biophysischen Aufbruch erlebte, war die Welt erstarrt in diesen Machtblöcken und ich glaube, das hat sich sehr stark abgebildet in meiner Biografie. Dazu kommt, dass ich in einer Stadt aufgewachsen bin, die sehr geprägt war von diesem kalten Krieg: Thun war die grösste Garnison und beherrscht von der Armee, auch beherrscht von diesem militärischen Geist und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, wo mein Platz in dieser Stadt hätte sein können oder was ich dort hätte tun können, um ein einigermassen glückseliges Leben zu führen. Und gleichzeitig hätte ich auch nicht gewusst, wo ich hätte hingehen sollen. Daraus folgte die Perspektivlosigkeit.
Trotz der Perspektivlosigkeit haben Sie sich schon in jungen Jahren autodidaktisch gebildet, zum Beispiel durch die Lektüre von Hegel und Walser. Wie kam es denn, dass Sie so leseinteressiert waren und doch so schulverdrossen?
Meine Schulverdrossenheit hat ihren ursächlichen Grund wohl in meiner Lesemanie. Irgendwann ist man einfach verdorben für den Schulunterricht, wenn man begriffen hat, dass man seinen Neigungen sehr viel zügiger nachgehen kann, indem man sich seine eigene Lektüre aussucht. Ich habe auch gewisse Bücher gelesen, die man nicht in dem jungen Alter lesen sollte. Das hat mich natürlich ein bisschen altklug gemacht, was nicht so einfach für die Lehrer war. Andererseits stellt sich die Frage nach dem Warum: warum mich jetzt diese Leidenschaft, diese Begeisterung für das Lesen gepackt hat. Das bleibt verborgen in den psychologischen Strukturen, darauf habe ich auch keine Antwort. Es gibt jedoch ein äusseres Ereignis: Als ich ungefähr acht Jahre alt war wurde mir ein 25-bändiges Lexikon vermacht. Die Zügelmänner haben mir diese zwei Bananenkisten überreicht, ich habe dann einen Anhänger organisiert und bin mit ihnen nach Hause gefahren. Von da an war ich eigentlich verloren. Das war für mich Zeitvertreib und Träumerei, die Streifzüge durch dieses Lexikon. Ich liebe Lexika immer noch innig, das hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen. Wahrscheinlich gibt es einfach eine pathologische Neugier, die mir eigen ist. Ich bin wirklich krankhaft neugierig und es gibt eigentlich nichts, wofür ich mich nicht interessiere.
«Mich haben Lehrpläne oder eine gewisse Didaktik immer kalt gelassen – ich habe mich für Menschen interessiert.»
Gibt es denn ein Bildungssystem, das allen gerecht werden kann?
Ich denke nicht, dass es ein perfektes Bildungssystem gibt. Ich glaube nicht so sehr an Systeme, ich glaube an Beziehungen. Und ich glaube, dass man über Beziehungen lernt, jedenfalls ging es mir immer so. Mich haben Lehrpläne oder eine gewisse Didaktik immer kalt gelassen – ich habe mich für Menschen interessiert. Deshalb würde ich jedes System bevorzugen, das die Beziehung und daraus natürlich auch die Erfahrung gewichtet. Was ich immer suche, ist nicht so sehr die Information – wir sind nicht zuerst informationsverarbeitende Wesen – sondern die Erfahrung. Für die Erfahrung braucht es eine Biografie und Menschen, die auch bereit sind, diese biografischen Erfahrungen zu teilen.
Sehen Sie einen Grund dafür, dass Sie zu Ihrer Schulzeit durch die
Maschen des Bildungssystems gefallen sind?
Damals gab es die grosse Selektion mit neun oder zehn Jahren. In Malcolm Gladwells Buch „Outliers“ habe ich neulich gelesen, dass ein erheblicher Anteil der Eishockeyprofis in der NHL zwischen Januar und April geboren sind, und zwar aus einem ganz bestimmten Grund: weil sich Vorteile kumulieren. Wenn man nach Jahrgang einschult und einen ganzen Jahrgang zusammennimmt, dann haben jene, die am Ende des Jahres geboren wurden, immer einen Nachteil. Sie sind in der physischen Entwicklung nicht so weit wie jene, die am Anfang des Jahres geboren wurden. Bei der Eishockeyspielerförderung kumuliert sich das durch die Jahre. Jemand, der ab Oktober geboren wurde, ist physisch einfach nicht in der Lage mitzuhalten und bei mir war das offensichtlich auch der Fall. Ich habe am schlimmsten Tag des Jahres Geburtstag. Das einzige Positive daran ist, dass ich ihn mit dem grossen englischen Autor Rudyard Kipling teile, den 30. Dezember. Niemand will mit mir Geburtstag feiern: „Nicht schon wieder ein Fest, ich muss morgen nochmal.“ Ich glaube schon, dass sich in meinem Fall im Schulsystem eine Lücke aufgetan hat. Aber ich war auch ziemlich renitent. Auf Autoritäten habe ich immer sehr allergisch reagiert.

Lukas Bärfuss liest an der Universität Bern aus “Koala”. Bild: Sam von Dach
Die unterschiedliche Entwicklung verschiedener Schüler innerhalb eines
Schuljahrganges stellt auch heute noch eine Herausforderung dar.
Ich habe aus dieser Erfahrung meine eigenen Kinder später eingeschult, als ich eigentlich gekonnt hätte. Was nicht heisst, dass sie jetzt nicht schulische Schwierigkeiten haben. Man entkommt eigentlich diesen… (zögert) Es ist verrückt, jetzt gerade ist bei meinem ältesten Sohn der Eintritt ins Langgymnasium in Zürich aktuell und eigentlich ist das vollkommen überflüssig, weil man auch später noch die Gelegenheit dazu hat. Aber man kann sich dem Druck, der da ausgeübt wird, nicht entziehen, weil natürlich alle Mitschüler, Miteltern vom selben Wahn besessen sind und man steigt da hoch mit diesem Wahn. Als Einzelner kann man so etwas kaum lösen. Ich bin ein grosser Verfechter der Volksschule. Es würde mir wirklich erst als äusserste Massnahme in den Sinn kommen, meine Kinder auf eine private Schule zu schicken. Aber das bedingt auch, dass man in einem gewissen Zeitgeist verstrickt bleibt.
«Auf Autoritäten habe ich immer sehr allergisch reagiert.»
Es liegt in der Natur der Volksschule, dass sie gewisse Kompromisse eingehen muss, da es eine grosse Spannbreite an Schülern mit verschiedenen Lerntypen gibt.
Das ist sicher so. Ich glaube trotzdem, dass es in unserem Bildungssystem etwas gibt, was mir auch gesamtgesellschaftlich grosse Sorgen bereitet: die Hegemonie des Wettbewerbs. Das heisst, dass wir in die Schule gehen und uns bilden, um uns dem Wettbewerb zu stellen. Ich habe grundsätzlich nichts gegen Konkurrenzsituationen. Schon Sophokles stand mit Euripides in einer Konkurrenz, wer das beste Stück geschrieben hat. Ich glaube, der Wettbewerb ist auch der Kunst eigen. Ich glaube nur nicht, dass die Konkurrenz überall alles bestimmen sollte, denn Wettbewerb hat eine ganz spezifische Eigenschaft: Er macht konform. Der Konformismus ist eine direkte Folge des Wettbewerbs. Wenn wir bei den Sportlern sind: Sportler stehen in einem direkten Konkurrenzverhältnis, das nach einem bestimmten Regelkatalog verläuft, zueinander. Dieser Regelkatalog führt dazu, dass alle Sportler einer bestimmten Sportart dasselbe essen, dieselben Trainings machen, dieselbe Ausrüstung tragen – einfach, um kompetitiv zu bleiben. Das ist eine direkte Folge des Wettbewerbs, weil man natürlich innerhalb der Regelhaftigkeit mit dem Fortschritt gehen muss, die neuesten Methoden der Trainingswissenschaft, der Ernährungswissenschaft mitvollziehen muss, um standhalten zu können. Wenn wir das auf unsere Gesellschaft ausweiten, erkennen wir einen grossen Unterschied zum Sport: Bei uns hat der Wettbewerb kein Ende.
Was bedeutet das für das Individuum?
Wir können uns niemals ausruhen, wir haben keine Gelegenheit zu sagen: „Jetzt treten wir vom Wettbewerb in etwas anderes über.“ Und wenn wir das Bildungssystem oder das ganze Leben auf diese total spezifische Situation zurückstutzen, dann verpassen wir ganz viele Facetten der Existenz und der Beziehungen der Menschen untereinander. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass die Konkurrenz das Wichtigste ist, was eine Volkswirtschaft erfolgreich macht. Wenn Sie sich vorstellen, was es gebraucht hat, damit wir uns hier treffen können und noch etwas trinken dazu, dann braucht es eine Zusammenarbeit von unglaublichem Masse: Es brauchte einen Zug, der mich hierher geführt hat. Es brauchte jemanden, der die Getränke geliefert hat. Sie mussten ihre Apparate kaufen. Die Kooperation war da sehr viel wesentlicher als der Wettbewerb, der auch notwendig ist. Aber diese Hegemonie, die wir erleben, die ist schädlich.
«Wettbewerb hat eine ganz spezifische Eigenschaft: Er macht konform. Der Konformismus ist eine direkte Folge des Wettbewerbs.»
Selbst wenn es das Ende des Wettbewerbs in unserer Gesellschaft gäbe, würde ein Kind dies gar nicht wahrnehmen, denn es lebt, wie Sie schreiben, „in der Ewigkeit des Moments“.
Kinder steigen immer wieder in den Wettbewerb ein und wieder aus dem Wettbewerb aus. Sie begreifen, dass es eine Weile durchaus reizvoll im besten Sinne sein kann, wenn man sich um etwas balgt, um ein Spielzeug oder darum, wer schneller ist. Denn es versetzt einen natürlich in eine gewisse Spannung und erhöht die Aggressivität. Aber Kinder steigen immer wieder aus, weil sie an dieser Wettbewerbssituation ermüden. Sie suchen dann etwas anderes, nämlich das gemeinsame Spiel, das Einigen auf das gemeinsame Spielfeld.
Begeben wir uns nun auf das Spielfeld der nationalen Politik. Wie gehen Sie mit dem Missstand um, dass in der politischen Debatte der Schweiz immer nur in nationalen Interessenlagen gedacht wird?
Da gibt es natürlich verschiedene Reaktionen meinerseits. Manchmal ist die Reaktion eine wütende, direkt betroffene, aber meistens ist es eine Einsicht in die Aporien und Widersprüche unserer Politik. Bei den letzten Nationalratswahlen ist mir das wieder aufgefallen. Ich erhalte die kantonale Liste des Kantons Zürich und ich frage mich, wo dieses Territorium, der Kanton, in meinem Leben noch irgendeine Rolle spielt. Nirgendwo! Nur bei den Nationalratswahlen. Gut, man kann sagen, ich bin vielleicht noch im ZVV, dem Zürcher Verkehrsverbund, wenn ich mit dem Zug irgendwohin reise. Die Steuern bezahle ich auch noch. Aber grundsätzlich ist das keine Grösse mehr für mich. Meine Grösse ist entweder das Viertel, in dem ich lebe, der deutschsprachige Raum oder dann ist es die ganze Welt. Medial ist es die ganze Welt, kulturell ist es die ganze Welt – meine Kinder hören Musik aus Südkorea, nicht aus dem Kanton Zürich.
«Ich glaube zum Beispiel nicht, dass die Konkurrenz das Wichtigste ist, was eine Volkswirtschaft erfolgreich macht.»
Inwiefern ist das Festhalten an alten territorialen Vorstellungen denn problematisch?
Wenn ich mir vorstelle, dass ich die Vertreter meiner Interessen aufgrund eines kantonalen Territoriums wähle, dann sehe ich einfach, dass diese Idee des föderalen Nationalstaates und der Existenz einer territorialen Hoheit, eines Hoheitsgebiets überhaupt, nicht mehr zeitgemäss ist. Die Frage, die sich jetzt jenseits unserer persönlichen Wut oder Enttäuschung beispielsweise in der Flüchtlingsfrage stellt, ist: Wie können wir politische Teilhabe im 21. Jahrhundert institutionell abbilden? Wie wird das möglich sein? Diese Frage ist für meine Generation wahrscheinlich ziemlich erledigt, wir sind mittlerweile zu alt. Aber für Ihre Generation wird das die grosse Frage sein. In welchen Institutionen können Ihre freiheitlichen Rechte wahrgenommen werden? Dies zeigt sich gerade bei Persönlichkeitsrechten, von denen der Staat behauptet, er könne sie wahrnehmen, schliesslich gäbe es ein Strafgesetzbuch. Wenn jemand Ihre Persönlichkeitsrechte verletzt, behauptet der Staat, könne er sich an Ihrer Stelle dagegen wehren. Doch das ist einfach nicht der Fall, wie man an Facebook und Twitter sieht. Wenn Sie dort verleumdet werden, wenn es eine Rufmordkampagne gegen Ihre Persönlichkeit gibt, dann wird die Kantonspolizei Bern dagegen nichts machen können und zwar überhaupt nichts. Dann müssen Sie nach Palo Alto gehen, ins Silicon Valley und dort einen Anwalt nehmen. Wir sehen es auch bei Thematiken wie den Fake-News: Wer hat da überhaupt noch die Möglichkeit, die Rechte durchzusetzen?
Plädieren Sie für eine stärkere Einbindung der Schweiz in supranationale Organisationen?
Offenbar hat diese Idee gerade in den letzten Monaten ziemlich Schiffbruch erlitten. Wir sehen, dass immer weitere Teile der Bevölkerung dies ablehnen und es ein grosses Misstrauen gegenüber diesen supranationalen Institutionen gibt, gegenüber der Europäischen Union zum Beispiel. Ich sehe die Alternative einfach nicht. Wenn mir jemand sagen würde, wer die grossen globalen Fragen beantworten oder durchsetzen könnte, dann wäre ich sehr schnell bereit. Ich glaube, es ist einfach „faute de mieux“ – wer sonst? Wer sonst soll meine Rechte wahrnehmen? Nicht die Kantonspolizei Bern, da bin ich sicher. Und das ist keine idealistische Sichtweise auf supranationale Institutionen, sondern reiner Pragmatismus.
«Wer sonst soll meine Rechte wahrnehmen? Nicht die Kantonspolizei Bern, da bin ich sicher.»
Sie haben den Generationenkonflikt angesprochen: Für Ihre Generation ist diese Frage bereits erledigt, für die unsrige wird es die zentrale Frage sein. Erklären Sie sich damit auch eine Polarisierung unserer Gesellschaft?
Die Bruchlinien werden immer deutlicher, zwischen den Generationen unbedingt. Für Sie wird das hoffentlich noch keine Rolle spielen, aber die Altersvorsorge beginnt bei mir jetzt langsam am Horizont zu dämmern. Jedes Mal, wenn ich versuche, irgendetwas darüber in Erfahrung zu bringen, stelle ich fest, dass eine konsistente Information nicht zu finden ist, weil alles total ideologisiert ist. Diese Ideologisierung ist etwas, was mir überhaupt nicht gefällt, denn sie trennt natürlich. Sie trennt die verschiedenen Bevölkerungsgruppen voneinander, weil es nicht mehr möglich ist, das gemeinsame Interesse zu formulieren. Ob Sie jetzt Mitte 20 sind oder ich Mitte 40 bin: Politik ist primär dazu da, unsere gemeinsamen Interessen zu formulieren. Davon sehe ich leider immer weniger.
«Ausserdem schert sich das Publikum – die Leute, die meine Bücher lesen und meine Stücke anschauen – nicht wirklich einen Deut darum, was in der Neuen Zürcher Zeitung steht.»
Sie polarisieren ebenfalls. Ihre politischen Äusserungen werden in den Medien kritisch diskutiert. Besonders seit Ihrem kontroversen Essay „Die Schweiz ist des Wahnsinns“ wurde die Wahrnehmung Ihrer literarischen Werke vermehrt durch diese Kritik verzerrt. Beispielhaft zeigt sich dies in der NZZ-Rezension Ihres neuen Theaterstücks „Frau Schmitz“ durch Daniele Muscionico. Fühlen Sie sich in solchen Momenten als Schriftsteller verkannt?
Nein, überhaupt nicht. Nur könnte ich ziemlich genau beschreiben, in welcher furchtbar peniblen Situation diese arme Theaterkritikerin war, wenn sie in einer Zeitung unter einem Chef, den ich doch ziemlich hart angegangen habe, ein Werk von mir besprechen muss. Zudem war es ihre erste Theaterkritik als neu angestellte Redaktorin. Sie kann mich auf der einen Seite nicht total verreissen, weil sonst alle denken, sie hätte nur den Willen ihres Chefs erfüllt. Auf der anderen Seite kann sie mich auch nicht total gut finden. Deshalb sehe ich vor allem die Beschreibung des Zwiespalts, in dem sie sich befindet (lacht). Ausserdem schert sich das Publikum – die Leute, die meine Bücher lesen und meine Stücke anschauen – nicht wirklich einen Deut darum, was in der Neuen Zürcher Zeitung steht. Was mich auch nicht richtig glücklich macht, weil ich eigentlich davon ausgehe, dass es gerade im Theater eine kritische Berichterstattung, die das Werk in einen Zusammenhang stellt, braucht. Kontextualisierung ist etwas, was ich leider überall vermisse, gerade auch in der Theaterkritik.



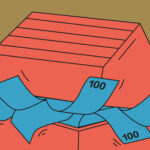



Liebe Studizytig
Danke für eure tollen Artikel! Ich freue mich, dass es euch jetzt auch online gibt ?
“Der Konformismus ist eine direkte Folge des Wettbewerbs”
Nice!!